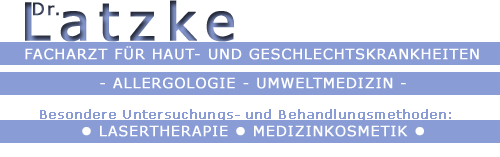
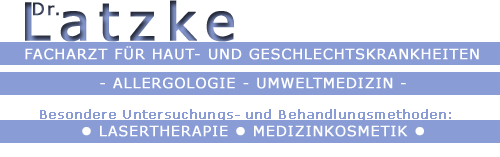
Vorbeugende Maßnahmen für Patienten
mit Neurodermitis und Allergien
|
Von den Kindern, die eine Neurodermitis entwickeln, erkranken bereits 75% im 1. Lebensjahr und 85% innerhalb der ersten 5 Lebensjahre.Die Allergiehäufigkeit scheint insbesondere in den ersten drei Lebensjahren anzusteigen. Vorbeugenden Maßnahmen, die das Fortschreiten der allergischen Reaktionen verhindern können, kommt somit eine entscheidende Bedeutung bei. Noch sind nicht alle Faktoren bekannt, die die Entstehung einer Neurodermitis begünstigen und den Krankheitsverlauf bestimmen. Während im Säuglings- und Kleinkindesalter Nahrungsmittel und Infekte häufige Provokationsfaktoren darstellen, kommen mit zunehmenden Lebensalter die Psyche (Stress), Allergene (bzw. Reizstoffe) aus der Luft (z.B. Pollen) und hormonelle Faktoren (z.B. Schwangerschaft) hinzu. Schwitzen, im Rahmen körperlicher Anstrengungen (z.B. Sport, Beruf), durch falsche Kleidung (z.B. Wolle) oder bei schwül-heißem Wetter stellt in jedem Lebensalter einen häufigen Provokationsfaktor der Neurodermitis dar (Irritation der Haut durch den körpereigenen salzigen Schweiß). Bekannt ist, daß das Allergierisiko für ein neugeborenes Kind durch eine allergische Vorbelastung der Eltern maßgeblich erblich mitgeprägt wird. So verdoppelt sich das Risiko für ein Kind an Neurodermitis zu erkranken wenn eines der Elternteile erkrankt ist, und sollten beide Elternteile an einer Neurodermitis leiden ist das kindliche Risiko ebenfalls zu erkranken gleich verdreifacht. Sollte auch nur ein Elternteil mit allergischen Erkrankungen vorbelastet sein, wie z.B. Neurodermitis oder Asthma, sollten vorbeugende Allergiemaßnahmen (Präventionsmaßnahmen) eingeleitet werden, da hierdurch die Entwicklung von Krankheitserscheinungen erfolgreich verhindert, verzögert oder abgeschwächt werden kann. |
 Für Allergiker und Neurodermitispatienten nicht empfehlenswert: Haustiere. |
Die bisher gesicherten Erkenntnisse berechtigen zu folgenden Empfehlungen, um die Entwicklung und das Fortschreiten einer Neurodermitis (Asthma) bereits im Kindesalter aufzuhalten:
1. Das häusliche Wohnumfeld sollte Tabakrauchfrei sein, d.h., es besteht absolutes Rauchverbot für die Familienmitglieder und später natürlich auch für den betroffenen Patienten.
Der Grad der Innenluftverschmutzung hängt heute in erster Linie von den Rauchgewohnheiten der Familie ab. Bekannt ist, dass nicht nur aktives Rauchen, sondern auch passives Rauchen die Allergieentwicklung unterstützen. Auch mütterliches Rauchen während der Schwangerschaft und Stillzeit begünstigt die Allergieentwicklung für das werdende Kind. So konnte gezeigt werden, daß Kinder, deren Mütter in der Schwangerschaft geraucht haben, in den ersten Lebensmonaten eine vierfach höhere Allergiemanifestation aufweisen, als Kinder, deren Mütter in der Schwangerschaft nicht geraucht haben. Darüber hinaus gilt als gesichert, dass mütterliches Rauchen während der Schwangerschaft zu einem erhöhten Risiko spontaner Fehlgeburten führt, eine um 20-30% erhöhte Häufigkeit einer vorzeitigen Ablösung des Mutterkuchens (Placenta) bewirkt, und eine erhöhtes Minderwachstum des ungeborenen Kindes begünstigt.
2. Nach der Geburt Ihres Kindes sollten Sie es mindestens 4 Monate lang ausschließlich stillen, ohne andere Nahrungsmittel zuzufüttern, insbesondere keine anderen Milchprodukte.
 |
Die Einhaltung einer allergenarmen Kost während der Schwangerschaft ist nicht nötig. Die Einhaltung einer mütterlichen allergenarmen Kost (Verzicht auf Milch, Ei, Fisch, Erdnuß, Soja) während der Stillzeit wird nicht empfohlen. Auf Sojamilch und Eier sollte aufgrund der hohen Allergenität in den ersten 12 Lebensmonaten vollständig verzichtet werden und erst später nach Überprüfung der Verträglichkeit zugefüttert werden. Kuhmilch (Vollmilch) sollte frühestens im zweiten Lebenshalbjahr gegeben werden und nur in begrenzter Menge (200 ml) im Brei (Abendbrei), nicht aber für die Flasche verwendet werden. |
3. In Haushalten von Allergikern sollte auf felltragende Tiere verzichtet werden. Der Verzicht gilt gleichermaßen für verarbeitete Tiermaterialien in den Betten (wie z.B. Daunenbetten).
Felltragende Tiere stellen das Reservoir für eine Fülle von Allergenen dar. Bedingt durch ihren engen Kontakt im häuslichen Milleu sind für die Auslösung von Allergien Haustiere am bedeutsamsten (Goldhamster, Meerschweinchen, Hasen) allen voran Katzen. Aufgrund der geringen Sedimentationsgeschwindigkeit können Katzenallergene mit der Schwebeluft überall hingetragen werden und durch Passivtransport mit Kleidung und Schuhen auch an Orte gelangen, wo keine Katzen leben. Tierhaarallergiker und allergiegefährdete Patienten sollten dies bedenken, wenn sie z.B. Freunde in ihre Wohnung einladen, die Haustierbesitzer sind.
Gerade Katzenallergene sind auf Grund ihrer guten Bindung an Wohnungsstaub und den ausgezeichneten Schwebeeigenschaften besonders problematisch und können durch Hausputz und Staub saugen kaum eliminiert werden. So zeigte sich in Wohnungen, aus denen Katzen entfernt wurden, trotz intensiver Reinigungsmaßnahmen erst nach mehr als fünf Jahren die Allergenmenge, die auch in Häusern ohne Katze zu finden war. Hauptallergen der Katzen sind hierbei nicht die Haare sondern der Speichel und die Talgdrüsen der Tiere. Durch Lecken des Fells und Absonderung der Talgdrüsen werden die Haare so allergen kontaminiert und dienen dann als Träger der eigentlichen Allergene. Deshalb sollte auch auf "Kurzhaar"- und "haarlose Rassen" verzichtet werden.
Hingegen
kann ein Hund gehalten werden, sofern keine anderen Mitglieder im
Haushalt eine Allergie gegen Hunde haben (Mini-Review: Allergo Journal
2023, 32(5)14-16).
Fische und Terrarientiere sind nur bedingt ein Kompromiß, da die Möglichkeit der Sensibilisierung gegen das Fischfutter und die Steigerung der Luftfeuchtigkeit durch das Aquarium mit dem höheren Risiko einer Schimmelpilz- und Hausstaubmilbenallergenbelastung verbunden sein kann.
Auch die Verwendung tierischer Produkte in den Betten ("Naturhaarfüllungen" mit Roß- oder Lamahaar, Schaafschurwollkissen, Lammfelldecken, Daunendecken) begünstigt die Konzentrierung von Hausstaubmilben. Allergiker und allergiegefährdete Patienten sollten gerade auch im Hinblick auf die Verminderung der doch sehr häufigen Hausstaubmilbenallergien diese Maßnahmen berücksichtigen. Ausführliche Verhaltens- und Sanierungsmaßnahmen für Patienten mit Hausstaubmilbenallergie sind in unserer Praxisinformation Thema 8 beschrieben " Sinnvolle Sanierungsmaßnahmen für Patienten mit Hausstaubmilbenallergie".
4. Die Kinder sollten zu einer permanenten, sachgerechten und eigenständig durchgeführten Hautpflege erzogen werden.
Ein Leitmerkmal bei Patienten mit Neurodermitis ist
die von Natur aus zu trockene Haut auf Grund einer krankhaft
veränderten Zusammensetzung der Hautfette (Lipide). Hieraus resultiert
eine komplette
Barrierestörung der Haut, auch an klinisch scheinbar nicht
ekzematisierten Arealen.
Folgen dieser Barrierestörung sind neben einem erhöhten Wasserverlust
der Haut, die erhöhte
Irritierbarkeit, die erhöhte
Infizierbarkeit, als auch eine erhöhte
Allergiesierbarkeit der Haut.
Allein eine trockene Haut für sich löst Juckreiz aus, die den Patienten zum Kratzen reizt. Dies wiederum führt über bakterielle Infektionen der aufgekratzten Haut zur weiteren Unterhaltung einer entzündlichen Reaktion, die ihrerseits eine Abheilung verhindert, ein Teufelskreis der zum Selbstläufer wird und die Symptome der Krankheit immer weiter verstärkt. Die regelmäßige Rückfettung der Haut durch den Patienten ist daher ein wichtiger Baustein, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Rückfettende Maßnahmen sollten bereits bei der Körperreinigung durch Waschen, Baden oder Duschen zur Anwendung kommen. Hautrückfettende "Lipidduschöle" oder "Fettölbäder" sollten hier vorrangig eingesetzt werden.
Zum Baden sollten Sie einen rückfettenden Badezusatz ("Fettölbad") verwenden. Empfehlenswert ist solch ein Bad 2-3 mal pro Woche. Hierbei sollte die Badedauer nicht länger als 10 Minuten sein, da die Haut sonst zu stark aufgeweicht wird. Die Wassertemperatur sollte 35°C nicht übersteigen, da wärmeres Wasser eine starke Hauterwärmung fördert und somit Juckreiz auftreten kann. Nach dem Bad sollte die Haut nicht mit einem Handtuch trockengerieben sondern nur vorsichtig abgetupft werden, um den auf der Haut befindlichen Ölfilm nicht wegzuwischen.
Außerdem sollte die Haut von
neurodermitisgefährdeten Patienten regelmäßig, mindestens aber
1xtäglich mit einer rückfettenden Lotion gepflegt werden, die
idealerweise Harnstoff, Nachtkerzensamenöl oder Mandelöl enthalten
sollte. Diese Pflegepräparate sind rezeptfrei in der Apotheke
erhältlich.
Berücksichtigen sollte man bei der Körperpflege die aktuellen
klimatischen Verhältnisse. In den Sommermonaten eignen sich eher
Emulsionen mit einem höheren Wasseranteil. In den Wintermonaten, in
denen die Haut naturgemäß einer stärkerer Austrocknung unterliegt, sind
fettendere Cremes oder Salben zu bevorzugen.
Das prinzipielle Ziel dieser systematischen Hautpflegemaßnahmen bei Neurodermitikern oder allergiegefährdeten Kindern besteht darin, durch eine regelmäßig durchgeführte Pflege der gesunden Haut, der Therapie einer kranken Haut vorzubeugen. Nicht zum Einsatz kommen sollten pflegende Pflanzenextraktpräparate wie Kamille, Ringelblume, Arnika, Propolis oder ähnliches, da hier ein hohes Risiko einer allergischen Reaktion gegeben ist.
5.) Wählen Sie hautverträgliche Kleidung aus
Seide und aus reiner Baumwolle, um eine Verschlechterung der Haut infolge
Irritationen oder Allergien vorzubeugen.
Vermeiden Sie direkten Hautkontakt mit allergiesierenden Accessoires
z.B. nickelhaltigen Modeschmuck wie Ringe, Kettchen,
Uhrenarmbänder und Metallösen.
Kleidung ist einer der wichtigsten Provokationsfaktoren für die Neurodermitis. Allergische Reaktionen auf Kleidungsmaterialen sind selten, können aber insbesondere durch "AZO-Farbstoffe" ausgelöst werden, die in dunkel gefärbten Textilien vorkommen. Dunkel gefärbte Textilien, die direkt der Haut aufliegen (z.B. Strumpfhosen, T-Shirt, etc.), sollten daher von Patienten mit einer Neurodermitis gemieden werden.
Häufig wird eine Neurodermitis durch das irritative Potenzial bestimmter Textilien gefördert. Hier sind insbesondere synthetische Textilien (z.B. Polyamid wie Nylon und Perlon, Polyester und Polyacryl) und Wolle zu nennen, da hier zum einen eine direkte mechanische Hautreizung erfolgt (z.B. je gröber die Wolle ist) zum anderen aber auch durch ein vermehrtes Schwitzen unter diesen Textilien die Haut zusätzlich irritiert wird.
Sehr gute Hautverträglichkeit besitzen Stoffe aus "reiner Baumwolle", da sie gut die körpereigene Feuchtigkeit aufnehmen und die Haut atmen lassen. Auch lässt sich Baumwolle bei hohen Temperaturen (95°C) waschen, was einen hygienischen Vorteil bedeutet. Allerdings sollte das Trocknen von Baumwollwäsche bevorzugt an der freien Luft und nicht im Trockner erfolgen, da Trockner zu einer für Neurodermitispatienten ungünstigen Veränderung der Faserstruktur der Baumwolle führen.
Eine weitere Möglichkeit, den Tragekomfort von Baumwolle zu erhöhen, liegt in der Verwendung von Wäscheweichpflegemittel. Die landläufige Auffassung, dass Wäscheweichpflegemittel allergische Hautreaktionen hervorrufen können, wird durch die Literatur und praktische Erfahrungen nicht bestätigt. Die heute vorliegenden Untersuchungen ergeben keinerlei Hinweise, daß mit Weichpflegemittel gewaschene Textilien Hautirritationen hervorrufen können. Im Gegenteil zeigt sich, daß mit Weichspüler gewaschene Textilien über eine Verminderung der Reibung zwischen Textilien und Hautoberfläche ein geringeres Irritationspotential haben.
Für hautkranke Säuglinge und Kleinkinder haben sich "Neurodermitis-Overalls" aus reiner Baumwolle bewährt. Sie bieten, da die Hände mit eingepackt sind, zum einen Schutz vor bewussten oder nächtlich unbewussten Kratzattacken, zum anderen erhöht sich unter ihnen die Wirksamkeit der aufgetragenen Salben.
Insbesondere für schwere Verläufe einer
Neurodermitis mit wiederholten bakteriellen Infizierungen empfehlen
sich Spezialtextilien die sich als Neuentwicklung auf dem Markt
etabliert haben.:
Zum einen kommt eine versilberte
Microfaser mit einem geringen Faserdurchmesser
zur Anwendung, wobei die gute Hautverträglichkeit durch das hieraus
resultierende geringe Gewicht und einer hohen
Wasserdampfdurchlässigkeit gegeben ist. Eine antibakterielle Wirkung
dieser Microfaser-Textilie wird durch eine Versilberung der
Einzelfasern erreicht.
Ferner stehen Textilien aus speziell veredelter
Seide zur Verfügung, die ebenfalls durch
Reduktion der mikrobiellen Besiedlung der Haut zur Verbesserung der
Neurodermitis führen.
6. Neurodermitiker sollten wie jeder Nicht-Neurodermitiker nach den Empfehlungen der ständigen Impfkommission des Robert-Koch Instituts uneingeschränkt geimpft werden.
Die im frühen Kindesalter empfohlenen Impfungen führen nicht - wie manchmal von Eltern vermutet - zu einem erhöhten Risiko für Allergien oder Neurodermitis. Im Gegenteil, neuere Studien weisen auf einen statistisch gesehen günstigen Effekt erhaltener Impfungen für das Risiko von Allergien oder Neurodermitis hin.
Die Impfungen sollten zu den vorgegebenen empfohlenen Zeitpunkten durchgeführt werden. Eine therapeutisch gut eingestellte Neurodermitis ist kein Hinderungsgrund für eine Impfung, lediglich im Stadium einer bedeutsamen Verschlechterung der Neurodermitis sollte die Impfung verschoben werden.
Neben den allgemein empfohlenen Impfungen sollten Kinder mit mittlerer bis schwerer Ausprägung der Neurodermitis eine zusätzliche Impfung gegen Windpocken erhalten, da diese ansonsten sehr schwer verlaufen könnten.
7. Vorrangig das Bett und Schlafzimmer von Allergikern sollte auf Hausstaubmilben saniert werden.
Zu den wirksamsten Mitteln der Hausstaubmilbensanierung zählen neben einer regelmäßigen Reinigung der Wohnung, glatte Böden und eine Einrichtung ohne "Staubfänger". Das Bettzeug (Kissen, Zudecke, Kuscheltiere) sollte regelmäßig (alle 6 - 8 Wochen) bei 60 Grad waschbar sein und die Matratze mit einem milbendichten Matratzenüberzug umspannt sein. Kuscheltiere von Kindern die nicht bei 60 Grad waschbar sind, sollten mindestens einmal monatlich für 12 Stunden ins Eisfach gelegt werden (tötet die Milben ab) und anschließend mit 30 Grad gewaschen werden (entfernt die Milbenreste).
Insbesondere für Kinder mit Asthma sind solche Sanierungsmaßnahmen mit einer deutlichen Verbesserung ihrer Beschwerden verbunden, und sollten deshalb in der gesamten Bandbreite der Maßnahmen umgesetzt werden. Hierzu verweise ich auf meine Praxisinformation Thema 8: "Sinnvolle Sanierungsmaßnahmen für Patienten mit Hausstaubmilbenallergie".
Auf die Ekzemschwere von Neurodermitiskranken Kindern sind die Effekte einer Milbensanierung nicht sicher belegt, und werden daher als primäre Präventionsmaßnahme nicht empfohlen.
8. Rechtzeitig die richtige Berufswahl planen: Feucht-, Nässe- sowie Staubberufe sind auf Grund einer erhöhten Irritationsgefahr für Allergiker zu vermeiden.
Aufgrund der gestörten Rückfettungsmechanismen und der damit verbundenen Barrierestörung der Haut ist der neurodermitiskranke oder neurodermitisgefährdete Patient für Irritanzien wie Feuchtigkeit, Nässe und Stäuben in erhöhtem Maße anfällig. Gleiches gilt für den Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen, die die Haut reizen oder auch allergische Reaktionen auslösen können.Unter anderem würden sich für Neurodermitis-Patienten folgende Berufe eignen:
9.
Der nächste Sommer kommt und mit ihm die Sonne: Sonnenschutzcremes auf
Basis „mineralischer“ Substanzen sollten bevorzugt angewendet werden.
Prinzipiell gibt es 2 verschiedene Wirkmechanismen der Lichtschutzfilter in den käuflichen Sonnenschutzcremes:
Insgesamt gesehen ist die Prognose einer Neurodermitis im Kindesalter eher günstig als wie für viele Eltern - aufgrund unzureichender Aufklärung - besorgniserregend oder gar angsterweckend.
So dominieren mit über 80 % der Fälle leichte Krankheitsverläufe, während die Erkrankung in nur 2 % einen wirklich schweren Verlauf nimmt. Ebenso mag die Eltern betroffener Kinder bei Ausbrechen der Erkrankung im Kleinkindalter beruhigen, dass sich die Aktivität der Neurodermitis mit zunehmendem Alter verliert. Während im Kindesalter die Neurodermitis mit einer Häufigkeit von 10 % sogar die häufigste Hauterkrankung darstellt, zeigt sich im Erwachsenenalter nur noch eine Häufigkeit von ca. 3 %, d.h. ca. 70 % der ehemals betroffenen Kinder verlieren ihre Neurodermitis wieder ("die Allergie wächst sich aus").
Die
konsequente Umsetzung und Beachtung der hier aufgeführten
Präventionsmaßnahmen soll und kann diesen Ausheilungsprozess aktiv
unterstützen.
 |
Dr. med. Frank Latzke ist zertifizierter Neurodermitis-Trainer nach den offiziellen Richtlinien der ArbeitsGemeinschaft NEurodermitisSchulung (AGNES). |
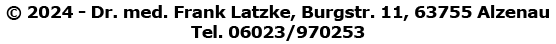
Die vorliegende Patienteninformation meiner Praxis wurde für Sie nach dem heutigen Stand des ärztlichen Wissens auf der Basis der aktuellen medizinischen Fachliteratur erstellt.
Bild
1 mit freundlicher Genehmigung der ALK-Scherax Arzneimittel GmbH
Bild 2 mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Haut-und
Allergiehilfe e.V.